Claims Management
Ablaufplan
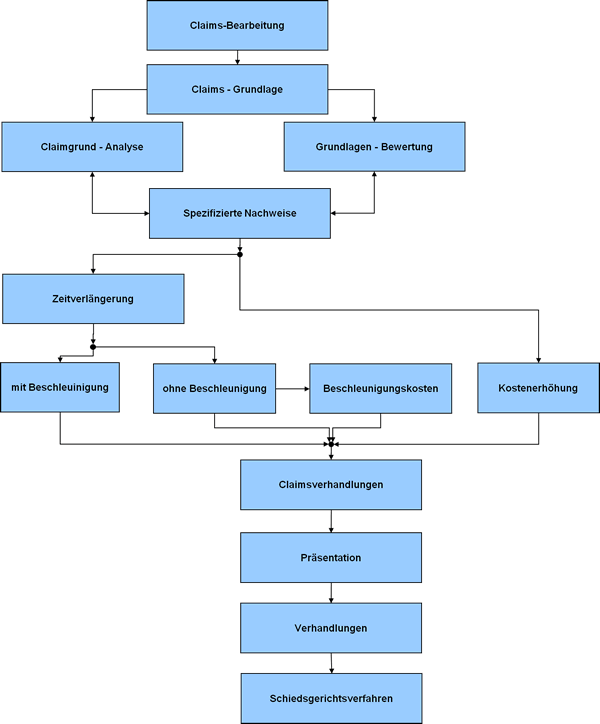
|
Herzlich Willkommen
Sehr geehrter Besucher,Diese Seite wurde erstellt um eine Hilfestellung für den täglichen Umgang mit Projekten zu bieten.Es wurde von mir darauf Wert gelegt einen Projektablauf möglichst chronologisch zu beschreiben, mögliche Abläufe zu definieren und eine Art Kochrezept zu liefern.Das mag weder für alle Projekte noch für alle Firmen in gleicher Art und Weise zutreffen. Dieser Anspruch wird hier auch nicht verfolgt. Es ist ein Fallbeispiel mit möglichst vielen Beschreibungen und Anmerkungen um eine komplexe Aufgabe, wie viele Projekte nun einmal darstellen können, in ihre kleinsten Bestandteile auf zu brechen sowie Vorgänge darin zu beschreiben.Die angebotenen Downloads zur freien Nutzung und Änderung an Ihre betrieblichen Gegebenheiten spiegeln in gleichem Maß eine Möglichkeit dar Projekte, auch ohne Softwareunterstützung wie MS-Projekt, kontrolliert in den Griff zu bekommen, zu strukturieren, analysieren, verifizieren und somit die Projektarbeit ein wenig zu erleichtern.Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Projektarbeit.
Einleitung
Welche Mindestvoraussetzungen benötige ich, um ein neues Projekt mit Aussicht auf Erfolg starten zu können?
Die "richtigen" Projektteammitglieder in Bezug auf:
Welche Maßnahmen könnten mir darüber hinaus beim Start eines Projektes helfen?
Zieldefinition
Was ist die Zieldefinition eines Projektes?
Die Zieldefinition eines Projektes ist ein klar vorgegebener Punkt, an dem das Projekt zu Ende ist. Das bedeutet, dass ein sauberer Projektabschluss nur unter der Voraussetzung eines richtig definierten Projektziels durchgeführt werden kann.
Die Zieldefinition ist in der Regel das Ergebnis eines Abstimmungsprozesses zwischen dem Auftraggeber und dem (künftigen) Projektleiter. Das Projektziel besteht häufig aus:
Wieso sollte ein Projektziel definiert sein?
Wie sollte eine Zielformulierung aussehen?
Folgende Attribute sollten Sie einem richtig formulierten Projektziel zuordnen können:
Folgende Tipps können dabei helfen das Projektziel richtig zu formulieren:
In der Regel hängen die beiden Parameter Termin und Kosten (Budget) von der inhaltlichen Ausgestaltung des Projektziels ab.
Aus diesem Grund gibt es durchaus auch Projekte, in denen im ersten Schritt nur das inhaltliche Projektziel definiert wird. Erst nach einer sog. Voruntersuchung, einer ersten Grobplanung des Projektes (die Methoden entsprechen den im Kapitel Projektplanung beschriebenen, jedoch auf einer weniger detaillierten Ebene) werden Termine und Kosten errechnet und zwischen Projektleiter und Auftraggeber vereinbart.
Als Faustregel könnte gelten:
Termine und Kosten gehören dann zum Projektziel, wenn das inhaltliche Ziel für den Auftraggeber bei Kosten- und Terminüberschreitung weitgehend wertlos wird. (zum Beispiel: Vorbereitung einer Messepräsentation)
Projektorganisation
Was ist die Projektorganisation?
Projekte erfordern aufgrund ihrer Komplexität häufig das Zusammenwirken verschiedener Abteilungen eines Unternehmens. Um die Projektabwicklung trotzdem effizient gestalten zu können, wird für jedes Projekt eine eigene Projektorganisation aufgebaut, die nur für die Dauer eines Projektes existiert - im Gegensatz zur "normalen" Linienorganisation eines Unternehmens.
Es gibt grundsätzliche Unterschiede zwischen Projektorganisation und Linienorganisation:
| Projektorganisation | Linienorganisation |
|---|---|
Temporär - wird aufgelöst, wenn das Projekt beendet ist. | Permanent - unterliegt normalerweise keinen oder nur relativ seltenen Änderungen. |
Orientiert sich an dem zu erreichenden Ziel (Projektziel). | Orientiert sich an den zu erledigenden Aufgaben eines Unternehmens (z.B. Marketing, Personal, Konstruktion, Fertigung). |
Ist in der Regel interdisziplinär besetzt. | Vereinigt in der Regel je Organisationseinheit Spezialisten einer Fachrichtung. |
Die Projektorganisation besteht im Kern aus:
Um den Auftraggeber zu entlasten, werden häufig noch ein oder mehrere, zusätzliche Entscheidungsgremien eingerichtet, wie z.B. ein Lenkungsausschuss, ein Steuerungskreis oder eine Abstimminstanz.
Außerdem können andere Rollen wie z.B. Qualitätssicherung oder Konfigurationsmanagement die Projektorganisation noch ergänzen.
Die Projektorganisation muss in einem firmenspezifischen PM-Konzept definiert und jeweils zu Beginn eines Projektes um die darin konkreten fachlichen Aufgaben erweitert werden.
Was ist eine Projektrahmenorganisation?
Die Projektorganisation wird durch Rollenbeschreibungen definiert, in denen die Aufgaben, Befugnisse und Verantwortung aller Projektbeteiligten m&oml;glichst eindeutig festgelegt sind. Damit werden insbesondere organisatorische Konflikte (z.B. zwischen Projekt- und Linienorganisation) zwischen den Beteiligten vermieden.
Aus diesem Grund müssen die Rollen bereits vor dem eigentlichen Projektstart klar beschrieben sein. Möglichst in Form einer firmenweiten Regelung, die für alle Projekte verbindlich vorgeschrieben wird. Der sogenannten Projektrahmenorganisation.
Projektdokumentation
Was ist die Projektdokumentation?
Die Projektdokumentation besteht aus allen wichtigen Texten, Zeichnungen und sonstigen Dokumenten, die dabei helfen, den Projektverlauf nachzuvollziehen. Ziel ist es, den Prozess zum Erreichen des Projektziels zu dokumentieren. Dazu dient in erster Linie die Projektakte, in der diese Dokumente abgelegt werden. Davon zu unterscheiden ist die Produktdokumentation, die das Ergebnis des Projekts (z.B. das Gerät, das entwickelt werden soll oder das EDV-System, das programmiert werden soll) dokumentiert.
Typische Dokumente in einer Projektakte sind:
Die meisten Projektplanungssysteme bieten vielfältige Möglichkeiten, den Projektverlauf zu dokumentieren. Hierzu gehören textbasierte Berichte und Grafiken, die in der Regel mit Hilfe von Filterfunktionen auf die speziellen Bedürfnisse der Projektbeteiligten zugeschnitten werden können. Beispiele: Kostenkurven- und Histogramme, Kapazitätsdiagramme, Statusreports usw.
Wieso ist es sinnvoll eine Projektdokumentation/Projektakte anzulegen?
Die Projektakte stellt sicher, dass jederzeit ein aktueller Stand der Projektplanung und des Projektauftrages inkl. Änderungsaufträgen existiert. In ihr finden sich zentral alle wichtigen Informationen zum Projekt. Ferner dient die Projektakte als wichtiges Hilfsmittel bei der Erstellung des Abschlussberichtes und der Erfahrungssicherung.
Wie kann eine Projektdokumentation/Projektakte aufgebaut sein?
Folgendes Inhaltsverzeichnis hat sich bewährt:
Natürlich kann eine Projektakte durchaus auch rein elektronisch (z.B. im Intra- oder Internet) mit einer entsprechenden Verzeichnisstruktur geführt werden. Wichtig ist jedoch in jedem Falle eine Regelung, wer für die Pflege verantwortlich ist und wo der jeweils gültige Stand zu finden ist. Es ist durchaus sinnvoll um allen Projektmitgliedern einen möglichst einfachen und schnellen Zugang zu allen relevanten Informationen zu bieten.
Kick-Off
Ein Projekt-Kick-Off ist die erste offizielle Sitzung des Projektteams, nachdem der Projektauftrag erteilt wurde. Sie dient noch nicht dazu, inhaltlich am Projekt zu arbeiten, sondern soll Gelegenheit für die Teammitglieder geben, sich über das Projektziel zu informieren und sich gegenseitig kennen zu lernen.
Was sind die Ziele des Projekt-Kick-off?
Der Projekt-Kick-Off soll verschiedenen Zielen dienen:
Vorstellung der einzelnen Teammitglieder
Um später auch die direkte Kommunikation im Projektteam sicherzustellen, muss jedem Teammitglied klar sein, wer welche Erfahrungen und Know-how-Schwerpunkte besitzt. Dies ist insbesondere auch wichtig für Themen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem eigentlichen Projekt-Thema stehen, da häufig Wissen aus anderen, angrenzenden Bereichen nützlich für die Lösung von Aufgabenstellungen ist. Ausserdem ist dies der geeignete Zeitpunkt, um die Erwartungen, Hoffnungen und Wünsche der Teammitglieder abzufragen und gegebenenfalls zu korrigieren.
Klärung der Rollen der einzelnen Teammitglieder
Für jedes Teammitglied gibt es bereits zum Beginn eines Projektes eine oder mehrere ihm zugedachte Rollen (fachlich und/oder organisatorisch) (siehe Kapitel Projektorganisation). Diese sollten während des Projekt-Kick-Offs angesprochen und eventuell korrigiert, beziehungsweise ergänzt werden.
Herstellen eines gemeinsamen Informationsstandes für alle Projektbeteiligten
Da im Vorfeld bis zu einem offiziellen Projektauftrag meist schon Gerüchte über das neue Projekt entstehen, sollten die Teammitglieder ganz zu Anfang insbesondere über das genaue Projektziel sowie die sonstigen Rahmenbedingungen informiert werden. Falls möglich, ist es sinnvoll, das Ziel noch einmal zur Diskussion zu stellen und so auch die Teammitglieder am Prozess der Zielfindung zu beteiligen.
Festlegen von Spielregeln für die Teamarbeit
Die Zusammenarbeit im Projektteam kann mit der Vereinbarung von Spielregeln konfliktfreier gestaltet werden. Sie sollten von allen Teammitgliedern gemeinsam erarbeitet werden, damit von Beginn an eine hohe Akzeptanz vorhanden ist. Am Ende des Tages müssen die Spielregeln von allen Teammitgliedern mitgetragen und umgesetzt werden. Das wiederum heißt nicht, hier findet jede Regelidee Anwendung. Das sprengte jeden Rahmen. Es geht um eine erste gemeinsame Absprache und Festlegung.
Folgende Themenbereiche können in die Spielregeln mit einbezogen werden:
Wie sollte ein Projekt-Kick-Off ablaufen?
Folgender Ablauf für einen Projekt-Kick-Off hat sich als sinnvoll erwiesen:
Die Sitzungsdauer sollte maximal 2 Stunden betragen.
Was sollte bei einem Projekt-Kick-Off vermieden werden?
Projektleiter
In jeder Gruppe oder in jedem Projekt nehmen deren Mitglieder verschiedene Rollen ein. Manchmal werden sie bereits im Voraus festgesetzt, oft bilden sie sich jedoch erst während der Gruppenbildungsphasen. Im folgenden Artikel soll die Rolle des Projektleiters näher definiert und erläutert werden.
Primär ist der Projektleiter für die operative Planung und Steuerung des Projektes verantwortlich. In diesem Zusammenhang trägt er die Verantwortung für das Erreichen von Sach-, Termin- und Kostenzielen im Rahmen der Projektdurchführung.
Im Bereich der Planung legt er Ziele sowie benötige Ressourcen für deren Erreichung fest:
Reichweite der Kompetenz eines Projektleiters
Die Reichweite der Kompetenzen eines Projektleiters hängt primär von der Leitungsstruktur der Projektgruppen ab. Hier werden zwei Arten unterschieden:
Bei hierarchiefreien Projektgruppen sind alle Gruppenmitglieder gleichberechtigt, sie tragen gemeinsam die Verantwortung für das Projektergebnis.
Im Gegensatz dazu wird in hierarchischen Projektgruppen ein Mitglied mit besonderer Kompetenz und Verantwortung ausgestattet.
Die Reichweite der Kompetenz hängt Grossteils von der Form der Projektorganisation ab und reicht vom lediglich abgebildeten Informations- und Antragsrecht bis hin zu uneingeschränkter Leitungskompetenz im Rahmen des Projektes. Sie kann sich im Laufe der Projektdurchführung durchaus verändern.
Aufgaben des Projektleiters
Im Rahmen der Projektplanung bestehen die Hauptaufgaben des Projektleiters in der Ressourcen- und Budgetplanung, sowie in der Zielsetzung des Projektes.
Projektdefinition
Möglichst präzises Formulieren realistischer Projektziele: Zustand, der am Ende des Projektes herrschen soll, Maßnahmen um den Sollzustand zu erreichen, sind nicht Teil der Zielformulierung. Wurden mit dem Auftraggeber noch keine konkreten Projektziele abgehandelt, ist es zentrale Aufgabe des Leiters, diese mit dem Auftraggeber abzustimmen. Weiter zählt hierzu die Dokumentation des Projektauftrages, um die Genehmigung des Projektes durch den Lenkungsausschuss zu sichern.
Gestaltung der Projektorganisation /-kultur sowie Zusammensetzung des Projektteams
Zur Projektorganisation zählen vor allem die Rollendefinition, die Integration des Projektes in die bestehende Unternehmensstruktur sowie der Aufbau projektbezogener Team- und Kommunikationsstrukturen. Bei der Zusammensetzung der Projektteams sind Qualität sowie Anzahl der Mitglieder zu beachten. Einerseits sollten alle wichtigen Interessengruppen vertreten sein, anderseits jedoch sollte die Größe des Teams nicht überschritten werden, da nur in Gruppen bis zu acht wirklich effizient gearbeitet werden kann. Die Projektleitung sollte außerdem mit einer gezielten Organisation Strukturen setzen, die das Chaos und daraus folgende Unsicherheiten begrenzen (Strukturierung in Projektstufen sowie Projektphasen).
Bilden von Projektplänen sowie deren Wartung
Der Projektleiter ist dafür zuständig, das Projekt effizient zu planen, zu koordinieren und zu steuern. Dabei helfen ihm traditionelle Instrumente wie die Netzplantechnik, die Projektkostenplanung und die Einsatzmittelplanung. Zu den neueren Instrumenten der Planung zählen auch die Projektdefinition, die Analyse des Projektumfelds, die Projektstrukturplanung sowie phasenbezogene Workshops (Projektstart-, Meilenstein-, Projektabschlussworkshop).
Oben genannte Instrumente helfen, Projekte in ihrer Gesamtheit zu betrachten, Abhängigkeiten darzustellen sowie die projektinterne Kommunikation zu erleichtern.
Gestaltung des Projektinformationssystems und der Kommunikation
Umfeld Management
Die Mitglieder von Projektteams werden oft von unterschiedlichen Abteilungen zusammengefasst, wobei abteilungsbezogene Interessen entstehen. Zur besseren Verständlichkeit: In einem Projekt zur Produktentwicklung beispielsweise, strebt die technische Abteilung vordergründig eine technologische Lösung an, wogegen der Vertrieb wiederum ein wettbewerbsfähiges Produkt wünscht. Hierbei ist es Aufgabe des Projektleiters eine so genannte Integrationsfunktion zu übernehmen:
Projektcontrolling
Im Zusammenhang mit Projektcontrolling überwacht der Projektleiter die Projektleistung, Termine und Kosten sowie deren Übereinstimmung mit definierten Projektzielen. Die Übertragung dieser Tätigkeit an ein Teammitglied ist in der Praxis üblich (Projektcontroller).
Projektdokumentation
Der Projektleiter ist dafür zuständig, dass vom Projekt betroffene Abteilungsleiter regelmäßig informiert werden und zu vereinbarten Zeitpunkten, oder bei Bedarf, die Projektergebnisse gemeinsam abgestimmt werden (z.B. im Beratungsausschuss). (Lit.: Patzak/Rattay)
Mitarbeiterführung in Projekten
Der Projektleiter führt Mitarbeiter oft ohne deren direkter Vorgesetzter zu sein (disziplinarische Unterstellung). Auch ohne diese direkte Macht möchte der Projektleiter, dass in seinem Projekt motiviert und verlässlich gearbeitet wird - in der Praxis ist dies oft schwer durchzusetzen und nur durch hohe Motivation seitens des Projektleiters zu bewerkstelligen. Wie bereits erwähnt, hängt die Führung der Mitarbeiter von der jeweiligen Leitungsstruktur ab. Dabei fallen dem Leiter folgende Aufgaben und Kompetenzen zu:
In der Praxis werden häufig vom Organisationsproblem betroffene Personen als Projektleiter eingesetzt, um zu verhindern, dass organisatorische oder informationstechnische Angelegenheiten gegenüber den Interessen der Betroffenen überwiegen. (Lit.: Schulte-Zurhausen)
Folgende Qualifikationen sowie Fähigkeiten sollte ein Projektleiter aufweisen:
Die Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. (GPM) formuliert es nach den Führungskompetenzen:
Hier wird auch verstärkt auf die Sozialkompetenz hingewiesen, da in Projekten vor allem der Mensch im Mittelpunkt steht.
Einleitung
Warum sollte eine Projektplanung durchgeführt werden?
Erst nachdem man ein Projekt geplant hat, bekommt man einen Überblick, welche Schritte sinnvollerweise als nächste zu tun sind. Die Projektplanung gibt also Sicherheit, das richtige zur richtigen Zeit zu tun. Eine fundierte und realistische Projektplanung ist ferner die Basis für eine funktionierende Projektsteuerung. Sie wird wie eine Landkarte verwendet, die es erlaubt, das Abweichen vom richtigen Weg möglichst frühzeitig festzustellen - nicht erst wenn man sich hoffnungslos verfahren hat. Ausserdem motiviert das Erreichen von Zwischenzielen den weiteren Weg bis zum Erreichen des Projektziels anzugehen. Oft merkt man erst dann, wenn man geplante Punkte als "erledigt" abhaken kann, dass eigentlich doch schon sehr viel realisiert wurde.
Wie gehe ich vor, um ein Projekt zu planen?
Der Aufbau einer kompletten Projektplanung erfolgt in 7 Schritten: | Was ist alles zu tun? |
|---|---|
| Projektstrukturierung: Team | - |
| Meilensteine setzen: Team | Welches sind wichtige Zwischenereignisse im Projektverlauf? |
| Aufwandsschätzung: Team | Wie viel Aufwand ist zur Erbringung von Arbeitsergebnissen notwendig? |
| Ablaufplanung: Team | In welcher Reihenfolge müssen die Arbeitspakete abgearbeitet werden? |
| Ressourcenplanung: Team | Sind die Ressourcen ohne Überlastung eingeplant? |
| Kostenplanung: Team | Wie viele Kosten verursachen die einzelnen Arbeitspakete? |
| Planoptimierung: Team | Stimmt der bis dahin geplante Projektablauf mit den Wünschen des Auftraggebers überein? |
| Risikoanalyse: Team | Was könnte das Projekt gefährden und welche Maßnahmen können eingeleitet werden? |
Ist die Projektplanung abgeschlossen, erfolgt in der Regel eine Genehmigung des Termin- und Kostenrahmens durch den Auftraggeber. Dazu ist es sinnvoll, diesen durch folgende Unterlagen zu informieren:
Take Care!
Arbeitspaketbeschreibungen, Netzpläne, Belastungsdiagramme oder sonstige Planunterlagen sollten nur dann weitergegeben werden, wenn dies ausdrücklich gewünscht wird, da sie Detailinformationen enthalten, die für den Auftraggeber erst in zweiter Linie interessant sind.
Welche Möglichkeiten und Grenzen bietet Projektmanagement-Software?
Projektmanagement-Software unterstützt den Anwender vor allem während des Planungs- und Controlling Prozesses. Allerdings sind auch hier Grenzen vorhanden wie die nachfolgende Tabelle zeigt.
| PM-Software leistet gute Dienste - | PM-Software übernimmt nicht - |
|---|---|
| bei der Verwaltung von umfangreichen Datenmengen | die Zieldefinition von Projekten |
| beim Arbeiten mit Standardplänen | den Aufbau einer Projektorganisation |
| bei der Berechnung, Änderung und Pflege von Netzplänen | die eigentliche Vorarbeit bei der Projektstrukturierung |
| bei der Optimierung von Projektplänen z.B. nach Ressourcen | die Aufwandsschätzung der einzelnen Arbeitspakete |
| bei der Analyse von Ist-Daten im Projektcontrolling | das Bestimmen notwendiger Anordnungsbeziehungen |
| bei der Simulation der Auswirkung von Steuerungsmaßnahmen | die Durchführung von Teamsitzungen |
| bei der Erfahrungssicherung von wichtigen Projektdaten | die Einbringung des "menschlichen Faktors" des Projektmanagements |
| bei der Veranschaulichung von Projektstrukturen und der logischen Anordnungsbeziehungen zwischen Projekttätigkeiten | - |
| beim Austausch von Informationen zwischen den Projektbeteiligten (Mail, bedürfnisgerechte Berichtsgenerierung, intra- und internetfähige Berichte etc.) | - |
| im Hinblick auf das Ausfindigmachen projektspezifischer Bedrohungen (z.B. durch Earned - Value- und Meilensteintrend - Analysen) | - |
Struktur
Was ist ein Projektstrukturplan?
Ein Projektstrukturplan (PSP) ist eine (in der Regel graphische) Übersicht, die alle zum Erreichen des Projektziels notwendigen Aktivitäten enthält. Der PSP wird von allen Mitgliedern des Projektteams gemeinsam erarbeitet. Neben den einzelnen Aktivitäten (man spricht oft auch von "Vorgängen") enthält er auch die Namen der Verantwortlichen für deren Durchführung.
Im Hinblick auf die Projektstrukturierungsmöglichkeiten sind beachtliche Unterschiede bei den gängigen PM-Systemen vorhanden. Die wenigsten Produkte unterstützen grafische Darstellungen. Auch die automatische Generierung unternehmensspezifischer Struktur-Codes mit Hilfe von Code-Masken beherrschen längst nicht alle Systeme.
Wozu soll ich einen Projektstrukturplan erstellen?
Für die Erstellung eines Projektstrukturplans sprechen mehrere Gründe:
Nach welchen Prinzipien kann ich ein Projekt strukturieren?
Ausgehend vom zu erreichenden Projektziel (= objektorientiert, produktorientiert) ->
Hierbei wird das vereinbarte Projektziel, also z.B. ein neues Messgerät, das Personalentwicklungskonzept oder die neue Software in seine Bestandteile zerlegt:
| Projektziel | Produktorientierung |
|---|---|
| Entwicklung Messgerät | - Hardware - nahe Firmware - Benutzer-Software - Hardware - Elektrik - Hardware - Mechanik (Gehäuse) - Dokumentation |
| neues Personalentwicklungskonzept | - Anforderungsprofil je Stelle - Mitarbeiterprofil - PE-Maßnahmen |
| Entwicklung einer Lern-Software | - Lerninhalte - Übungen - Beispiele - Formulare - Storybook - Benutzeroberfläche inklusive Hilfe - Begriffsdefinitionen |
Ausgehend vom Weg zum Erreichen des Projektziels (= prozessorientiert, funktionsorientiert, phasenorientiert) ->
Hierbei wird der Weg, der zum Erreichen des Projektziels zurückgelegt werden muss, in kleinere, meist auch chronologisch geordnete Teilziele zerlegt:
| Projektziel | Prozessorientierung |
|---|---|
| Entwicklung Messgerät | - Entwicklung - Konstruktion - Realisierung Erstmuster - Test Erstmuster - Überarbeitung - Freigabe |
| neues Personalentwicklungskonzept | - Informationssammlung - Konzeption - Abstimmung mit Vorstand und Betriebsrat - Dokumentation - Einführung |
| Entwicklung einer Lern-Software | - Grobkonzept - Detailkonzept - Programming Testversion - Test - Überarbeitung - Programming Endversion - Test - Überarbeitung - Vervielfältigung |
Grundsätze bei der Projektstrukturierung:
Wichtigstes Ziel des PSP ist die Vollständigkeit aller Aktivitäten. Zu beachten ist, das alle Aktivitäten klar voneinander abgegrenzt werden, vor allem um Überschneidungen zu vermeiden.
In der Regel werden in einem Projektstrukturplan immer beide Gliederungsprinzipien vorkommen (dann spricht man vom sog. gemischtorientierten Projektstrukturplan). Man sollte jedoch versuchen, ein Element nur nach einem einheitlichen Prinzip zu detaillieren. Dies ermöglicht erst die Überprüfung auf Vollständigkeit.
Risiken und Unklarheiten, die während der Projektstrukturierung auftauchen, sollten markiert und festgehalten und während des Projektverlaufs besonders beachtet werden.
Der PSP sollte soweit detailliert werden, bis allen Aktivitäten der untersten Ebene (=Arbeitspaket) genau 1 Verantwortlicher zugeordnet werden kann.
Ziel des Projektstrukturplans ist es nicht, eine Reihenfolge von Aktivitäten darzustellen. Der PSP dient ausschließlich zur inhaltlichen Zergliederung des Projektziels.
Arbeitspakete
Was sind Arbeitspakete und wozu dienen sie?
Als Arbeitspakete (AP) bezeichnet man die unterste Ebene im Projektstrukturplan. Diese ist dann erreicht, wenn einem Arbeitspaket genau ein Verantwortlicher zugeordnet werden kann. Dieser sorgt für die Einhaltung der zugesagten Termine und Kosten und die Erbringung der vereinbarten Ergebnisse.
Jedes Arbeitspaket ist eine klar abgegrenzte und in sich geschlossene Einheit. Die Arbeitspakete bilden die Basis für die weitere Projektplanung.
Wie wird ein Arbeitspaket beschrieben?
Zur näheren inhaltlichen Beschreibung eines Arbeitspaketes (die meist recht kurze Bezeichnung des Arbeitspaketes im Projektstrukturplan reicht nicht aus!) müssen mindestens folgende Informationen vorhanden sein:
optional:
Bei der Festlegung der zu erbringenden Ergebnisse eines Arbeitspakets sind die Grundsätze der Zieldefinition (siehe Kapitel Zieldefinition) zu beachten!
Meilensteine
Was sind Meilensteine?
Meilensteine sind wichtige Ereignisse im Projektverlauf und markieren den Abschluss von wichtigen Projektschritten. Sie ergeben sich aus der Projektstruktur, das heißt aus einer Zergliederung des Projektziels in Teilziele (diese können produkt- oder prozessorientiert sein - siehe auch Projektstrukturierung).
Wozu dienen Meilensteine?
Meilensteine sind Punkte, an denen eine Entscheidung über den weiteren Projektfortgang gefällt werden kann. So werden z.B. besonders wichtige Meilensteine als Gateway oder Review bezeichnet, bei deren Erreichen eine Review - Sitzung durchgeführt wird. Hierbei wird zunächst geprüft, ob die für diesen Meilenstein festgelegten Ergebnisse vorhanden sind. Außerdem wird eine Entscheidung gefällt, ob das Projekt wie geplant weitergeführt, abgebrochen oder in Teilen wiederholt wird.
Ein Meilenstein ist immer ein Ereignis (Ergebnisse sind vorhanden, Entscheidung ist gefällt), von dem sich eindeutig feststellen lässt, ob es eingetreten ist oder nicht. Deshalb kann darauf eine objektive Ermittlung und Darstellung des Projektstatus sowie ein fundiertes Berichtswesen aufbauen.
Meilensteine können zu sog. Meilensteinplänen zusammengefasst werden. Diese geben einen schnellen Überblick über die wesentlichen Eckpunkte der Projektplanung und sind deshalb auch zur Information des Managements geeignet.
Außerdem sind richtig definierte Meilensteine die Basis für ein interessantes Controlling-Instrument, die Meilenstein-Trend-Analyse (siehe Projektcontrolling).
Für den Marathonläufer werden wichtige Kilometersteine farbig markiert, um ihn für die verbleibende Reststrecke neu zu motivieren. Demselben Zweck dient auch das Definieren von Meilensteinen: Es motiviert, immer wieder "Zwischenspurts" einzulegen und nicht dem Frust des noch so weit entfernten Projektziels nachzugeben.
Fast alle PM-Systeme kennzeichnen Meilensteine mit Hilfe spezieller Symbole. Eine grafische Meilenstein-Trend-Analyse dagegen ist nur bei relativ wenigen Programmen vorgesehen, zum Beispiel bei Acos Plus.1. In fast allen Fällen kann auf das Programm Graneda Professional von Netronic zurückgegriffen werden, das die Projektdaten aus gängigen Projektmanagementsystemen importieren und anschließend eine grafische Meilenstein-Trend-Analyse erzeugen kann.
Wie werden Meilensteine definiert?
Zur Definition eines Meilensteins gehören:
Aufwandsschätzung
Wie gehe ich bei der Aufwandsschätzung vor?
Basis für die Aufwandsschätzung sind die Arbeitspakete aus dem Projektstrukturplan (siehe Projektstrukturierung). Jedes Arbeitspaket wird für sich alleine betrachtet. Folgende Vorgehensweise empfiehlt sich:
Der Aufwand hängt vom Arbeitsinhalt eines APs ab!
Nach der Aufwandsschätzung können die geschätzten Aufwände in die Projektmanagementsoftware übernommen werden.
Hinsichtlich der zu leistenden Aufwände stellen die meisten PM-Systeme mehr oder weniger differenzierte Berechnungsregeln bereit. So kann zum Beispiel bei vielen Projektplanungsprogrammen eingestellt werden, daß eine Verdoppelung der an einem Vorgang arbeitenden Ressourcen zu einer Halbierung der jeweiligen Vorgangsdauer führt. Dieser Automatismus führt allerdings nicht immer zu realistischen Ergebnissen (vgl. oben: "natürliche Obergrenze"). Auch die Abbildung variabler Kapazitätsverläufe ist nicht mit jeder PM-Software möglich. Beispiel: Ein Entwickler soll in der Anfangsphase eines Projektes an einem Vorgang nur wenige Stunden arbeiten und im weiteren Projektverlauf seine tägliche Stundenzahl steigern.
Was sind die häufigsten Fehler bei der Aufwandsschätzung?
Welche Verfahren unterstützen mich bei der Aufwandsschätzung?
Zur Unterstützung der Aufwandsschätzung in verschiedenen Phasen der Projektplanung gibt es verschiedene Methoden (z.B. function point, COCOMO, Erfahrungsdatenbanken), bei denen ein gewisses Maß an Erfahrung bei ähnlichen Projekten als "Input" zur Verfügung gestellt werden muss, damit als "Output" eine Aussage über den voraussichtlichen Aufwand eines Projektes getroffen werden kann. Außerdem sind in der Regel bereits relativ detaillierte Informationen über das Projekt notwendig, damit diese Methoden angewendet werden können.
Aus diesem Grund hat sich in der Praxis hauptsächlich die Expertenbefragung durchgesetzt. Dabei werden im Wesentlichen ein oder auch mehrere Experten über den ihrer Meinung nach zu erwartenden Aufwand für das Projekt oder Arbeitspaket befragt.
Zu einigen PM-Systemen existieren Module, welche die Aufwandsabschätzung (Function Point, COMO usw.) unterstützen
Ablaufplanung
Was ist Ablaufplanung und wozu dient sie?
Die in der Projektstrukturierung definierten Arbeitspakete können nicht immer parallel und völlig unabhängig voneinander abgearbeitet werden.
Viele Arbeitspakete weisen untereinander sachlich erforderliche, logische Abhängigkeiten auf (z.B.: erst muss der Rohbau stehen, bevor das Dach aufgesetzt werden kann). Diese müssen während der Projektplanung ermittelt und so dokumentiert werden, dass sie nachvollziehbar bleiben.
Das hierfür geeignete Instrument ist der Netzplan. In ihm werden die Arbeitspakete (siehe Kapitel Arbeitspakete) mittels sog. Anordnungsbeziehungen in die aus sachlichen Gründen erforderliche Reihenfolge gebracht.
Anmerkung: In der Begriffswelt der Netzplantechnik spricht man häufig von "Vorgängen" statt "Arbeitspaketen". Der Begriff wird aber meist gleichbedeutend mit Arbeitspaket verwendet.
Aufgabe des Netzplans ist im Wesentlichen:
Wichtig:
Die Arbeit mit Netzplänen ist nur dann sinnvoll, wenn eine Software bei der Berechnung zur Verfügung steht. Die manuelle Pflege eines Netzplans ist zu aufwendig.
Obwohl es sich bei den in PM-Systemen zur Anwendung kommenden Netzplänen fast immer um Vorgangsknoten-Netzpläne handelt, hat sich in der Praxis der Begriff "PERT" durchgesetzt, der ursprünglich Ereignisknoten-Netzpläne bezeichnete. Heutzutage weist der Begriff PERT meistens auf das Vorhandensein eines grafischen Netzplans hin.
Die Qualität der von PM-Systemen generierten Netzpläne ist sehr unterschiedlich. So stehen häufig keine rechtwinklige Verbindungslinien zwischen den Netzplanknoten bereit, wodurch sich bei komplexeren Projekten schnell ein unübersichtliches Bild ergibt.
Welche Anordnungsbeziehungen gibt es?
Anordnungsbeziehungen (AOB) stellen die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Arbeitspaketen im Netzplan dar. Folgende Arten von Anordnungsbeziehungen gibt es:
| Bezeichnung nach DIN 69900 | gebräuchliche Abkürzungen | Bedeutung |
|---|---|---|
| Normalfolge (NF) | EA (Ende-Anfang) ES (Ende-Start) |
Der Start des Nachfolgers ist vom Ende des Vorgängers abhängig. |
| Endfolge (EF) | EE (Ende-Ende) | Das Ende des Nachfolgers ist vom Ende des Vorgängers abhängig; die Startpunkte beider Vorgänge sind jedoch voneinander unabhängig. |
| Anfangsfolge (AF) | AA (Anfang-Anfang) SS (Start-Start) |
Der Start des Nachfolgers ist vom Start des Vorgängers abhängig; die Endpunkte der beiden Vorgänge sind jedoch voneinander unabhängig. |
| Sprungfolge (SF) | AE (Anfang-Ende) SE (Start-Ende) |
Das Ende des Nachfolgers ist vom Start des Vorgängers abhängig. |
Zusätzlich kann jeder Anordnungsbeziehung ein sog. Zeitwert/Zeitabstand zugeordnet werden. Dieser bedeutet, dass die beiden durch die AOB verbundenen Arbeitspakete entweder um einen bestimmten Zeitraum auseinander liegen (positiver Zeitwert) oder überlappen (negativer Zeitwert).
Besonders häufig werden positive Zeitwerte in Verbindung mit End- oder Anfangsfolgen verwendet.
Wie werden kritischer Pfad und Puffer ermittelt?
Der kritische Pfad ist die Verbindung aller kritischen Arbeitspakete in einem Netzplan. Ein Arbeitspaket ist dann kritisch, wenn früheste und späteste Lage identisch sind.
Die früheste Lage eines Arbeitspaketes wird während der Vorwärtsrechnung ermittelt. Dabei wird für jedes Arbeitspaket berechnet, wann es frühestens beginnen (abhängig von seinen Vorgängern) bzw. enden (frühester Beginn + Vorgangsdauer) kann. Anschließend erfolgt die Rückwärtsrechnung. Hier wird für jedes Arbeitspaket festgestellt, wann es spätestens enden muss, um seine Nachfolger nicht mehr zu verschieben. Zieht man davon die Dauer ab, erhält man den spätesten Startzeitpunkt. Spätester Start- und Endzeitpunkt zusammen werden die späteste Lage genannt.
Arbeitspakete, die nicht auf dem kritischen Pfad liegen, bei denen also früheste und späteste Lage nicht identisch sind, haben einen Puffer.
Die überwiegende Anzahl der Projektplanungsprogramme kann dem Betrachter den kritischen Pfad durch entsprechende Farbmarkierungen veranschaulichen. Auf diese Weise wird deutlich, welchen Projektaktivitäten erhöhte Sorgfalt gewidmet werden muss, da deren Verzögerung eine Verschiebung des anvisierten Projektendtermins zur Folge hat!
Welchen Zusammenhang haben Balken- und Netzplan?
Der Balkenplan dient in erster Linie zur Visualisierung der Terminplanung. Die Terminplanung ergibt sich aus der Netzplanrechnung - das bedeutet, dass der Balkenplan vor allem die Ergebnisse aus der Netzplanrechnung in einer weniger abstrakten, leicht verständlichen Form darstellt.
| Netzplan | Balkenplan |
|---|---|
| Dient vor allem zur Steuerung und Simulation der Projektplanung. | Dient vor allem zur übersichtlichen Darstellung der Terminplanung. |
| Eine Selektion oder Sortierung der enthaltenen Arbeitspakete ist nicht sinnvoll. | Die enthaltenen Arbeitspakete können einfach selektiert und sortiert werden. |
| Zeigt in erster Linie die logischen Abhängigkeiten zwischen den Arbeitspaketen. | Zeigt in erster Linie die zeitliche Lage von Arbeitspaketen. |
| Ist für Präsentationen aufgrund seiner Komplexität ungeeignet. | Ist auch für Präsentationen geeignet. |
Eine Mischform zwischen Balken- und Netzplan ist der sog. "vernetzte Balkenplan". In ihm werden neben der zeitlichen Lage der Arbeitspakete auch die Anordnungsbeziehungen dargestellt. Dies ist vor allem für kleinere oder wenig vernetzte Projekte ein guter Kompromiss. Allerdings wird der vernetzte Balkenplan bei manueller Erstellung und Verwaltung ab einer gewissen Größe auch sehr schnell unübersichtlich.
Kostenplanung
Wozu dient die Planung der Projekt-Kosten?
In der Regel ist mit der offiziellen Erteilung eines Projektauftrages auch die Freigabe eines bestimmten Projektbudgets verbunden. Der Projektleiter ist dafür verantwortlich, im Rahmen dieses Projektbudgets das vereinbarte Projektziel zu erreichen.
Um die Höhe des Projektbudgets zu verifizieren, ist eine Abschätzung der voraussichtlichen Projekt-Kosten notwendig. Erst danach ist eine fundierte Aussage möglich, wieviel die Realisierung des Projektziels voraussichtlich kosten wird. Liegen die voraussichtlichen Projekt-Kosten über dem Projektbudget, muss der Projektleiter dies sofort mit dem Auftraggeber abstimmen. Wird eine entsprechende Budgetkorrektur abgelehnt, sollte dies auch von Auftraggeber-Seite sachlich zu begründen sein. Stimmen Kostenplanung und Projektbudget überein, so ist die Kostenplanung die Basis für eine kostenorientierte Projektsteuerung.
Wichtig:
Die Projekt-Kostenplanung beschäftigt sich ausschließlich mit den für die Abwicklung des Projekts anfallenden Kosten. Davon zu unterscheiden sind die Produktkosten, die z.B. für die spätere Herstellung oder Betreuung eines (im Rahmen des Projektes entwickelten) Produktes anfallen. Vor allem im Bereich der technischen Produktentwicklung gibt es hier eigene Methoden (z.B. target costing, Wertanalyse), um auch die Produktkosten im Rahmen der Projektrealisierung zu steuern.
Wie komme ich zu einer fundierten Projekt-Kostenplanung?
Basis für die Projekt-Kostenplanung ist der Projektstrukturplan (siehe Kapitel Projektstrukturierung), der eine vollständige Aufstellung aller für die Erreichung des Projektziels notwendigen Arbeitspakete beinhaltet. Deshalb reicht es aus, wenn die Kosten für die Realisierung aller Arbeitspakete bekannt sind - die Summe ergibt die geplanten Projekt-Kosten.
Zur Planung der Arbeitspaket-Kosten wird in erster Linie die Kostenartenrechnung angewandt. Dazu kann auf die Kostenarten des betrieblichen Rechnungswesens zurückgegriffen werden. Falls dies zu detailliert oder aus anderen Gründen ungeeignet ist, empfehlen sich folgende Kostenarten:
|
Kostenart |
Bedeutung |
|---|---|
| Personalkosten | Dazu gehören die bereits im Rahmen der Aufwandsschätzung geplanten Aufwände der einzelnen Ressourcen. Diese werden einfach mit dem entsprechenden Verrechnungssatz multipliziert, um die Personalkosten zu bekommen. |
| Materialkosten | Dies sind alle (Verbrauchs-)Materialien (z.B. Baumaterial, Rohstoffe für die Herstellung von Prototypen, Druck- und Papierkosten für die Erstellung eines Prospektes), die gekauft werden müssen, damit ein Arbeitspaket abgearbeitet werden kann. |
| Gerätekosten | Dies sind Kosten für die Anschaffung von Geräten (z.B. eine Baumaschine, Messgeräte, ein neuer PC oder auch eine neue Software) zur Unterstützung des Projekts. Da diese Geräte in der Regel über das Projektabschluss hinaus genutzt werden, ist es sinnvoll, die Anschaffungskosten nur anteilmäßig auf das Projektbudget anzurechnen. |
| sonstige Kosten | Dazu gehören Kosten, die in die obigen drei Kategorien nicht zuordenbar sind, wie beispielsweise Reisekosten, Aufwendungen für Geschenke oder ähnliches. |
Diese Kostenarten sind dem Projekt direkt zuordenbar. Im Unternehmen anfallende Gemeinkosten wie bspw. Miete für Betriebsgebäude, Heizung, Strom, Raumpflege, etc. sind in der Regel bereits über den Verrechnungssatz des Personals mit abgedeckt und werden nicht gesondert auf Projekte umgelegt.
Die meisten Projektmanagementsysteme leisten gute Dienste bei der Projektkostenplanung und -kontrolle. Zeitraumbezogene Kostenbetrachtungen im Hinblick auf bestimmte Einsatzmittel oder Projektvorgänge sind in der Regel leicht möglich. Allerdings weisen einige Produkte Schwächen auf, wenn es um die Realisierung einer "echten" Kostenarten- und Kostenstellenrechnung geht. Auch Kostenschwankungen und Überstundensätze lassen sich nicht mit allen gängigen PM-Systemen berücksichtigen.
Zunehmende Bedeutung gewinnt die sog. Earned – Value - Analyse (auch Arbeitswert-Analyse od. Ertragswert-Analyse genannt). Von den Projektmanagementsystemen ermittelte Earned – Value – Analyse - Kennzahlen helfen dem Projektverantwortlichen - die fachmännische Interpretation derselben vorausgesetzt - frühzeitig Kosten- und Terminabweichungen zu erkennen. Dadurch lassen sich ggf. noch rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten – „Teamwork (Einführung in die EDV-gestützte Projektplanung).
Planoptimierung
Wozu dient der Planungsschritt "Planoptimierung"?
Die bisher erstellte Planung berücksichtigt noch nicht das Umfeld des Projektes. So wurden bis jetzt weder die evtl. mit dem Auftraggeber vereinbarten Meilenstein-Termine eingearbeitet, noch die Verfügbarkeit von Ressourcen berücksichtigt.
Bei der Planoptimierung wird dies ganz systematisch nachgeholt.
Kriterien zur Optimierung?
Die für eine Planoptimierung relevanten Größen können sich auf eine oder mehrere der drei wichtigsten Planungselemente beziehen:
Planoptimierung nach Ressourcen?
Hauptinteresse bei der Optimierung eines Projektplanes wird i.d.R. die Auslastung von Ressourcen sein. Um diese mit in den Projektplan einzubinden, wird das sog. Belastungsdiagramm (auch Ressourcen - Histogramm oder Ressourcengrafik genannt) angewendet. Jedes Belastungsdiagramm besteht aus zwei Grundelementen:
Die Ressourcenverfügbarkeit bildet die voraussichtliche Kapazität ab, mit der die Ressource (also z.B. ein Mitarbeiter) für das Projekt zur Verfügung steht. Ist der Mitarbeiter in Urlaub, sinkt die Linie auf Null. Der Ressourcenbedarf ergibt sich aus der bisherigen Planung:
Die Größe der Fläche spiegelt den geschätzten Aufwand wider (siehe Kapitel Aufwandsschätzung), die zeitliche Lage ergibt sich aus der Netzplanrechnung (siehe Kapitel Ablaufplanung).
Die Gegenüberstellung von Verfügbarkeit und Bedarf gibt Auskunft darüber, ob die geplanten Aufwände in der dafür vorgesehenen Zeit erbracht werden können. Übersteigt der Bedarf die Verfügbarkeit (wie in der Graphik zu sehen), ist die Planung so nicht realisierbar. Sie muss nochmals optimiert werden:
Führen beide Planungsansätze nicht zum Ziel, nämlich das geforderte Ergebnis (Projektziel) in der geforderten Zeit zu erbringen, kann nur noch die Höhe des Aufwands (im Diagramm die schraffierte Fläche), also das Arbeitsvolumen reduziert werden - z.B. durch Verminderung des Auftragsumfangs oder der Qualität. (siehe Kapitel Projektsteuerung)
Zur Beseitigung von Einsatzmittelüberlastungen stellen die meisten Projektplanungssysteme die Möglichkeit eines automatischen Kapazitätsabgleichs bereit. Durch Ausnutzung von Pufferzeiten (zeitliche Spielräume) verschieben PM-Systeme Projektvorgänge zeitlich so, dass Ressourcenüberlastungen gänzlich oder zumindest teilweise verschwinden.
Die Güte bzw. Qualität der in den PM-Produkten implementierten Abgleichsalgorithmen ist allerdings sehr unterschiedlich. Dadurch generieren die PM-Systeme bei einer gegebenen Problemstellung (Projektplan mit Einsatzmittelüberlastungen) sehr unterschiedliche Ergebnisse (Projektplan ohne Einsatzmittelüberlastung).
Zwar sind fast alle PM-Systeme in der Lage, Einsatzmittelüberlastungen zu beseitigen, aber die dabei erzeugten Projektpläne unterscheiden sich stark im Hinblick auf ihre Projektdauer ("Optimal Lösung (Krisenmanagement mit Projektplanungssystemen).
Wie ist die Vorgehensweise zur Terminoptimierung?
Ziel ist, die evtl. bereits vereinbarten Termine in die Planung mit einzubeziehen, insbesondere Meilensteine (siehe Kapitel Meilensteine), für die bereits ein Termin vereinbart wurde (z.B. "Pilotversion ist fertig gestellt bis 15.7."). Prinzipiell bedeutet das manuelle Festlegen von Terminen immer ein Eingreifen in die Netzplanlogik - was eigentlich vermieden werden sollte, um dem Netzplanalgorithmus maximale Freiheit zu gewähren. Meilensteine sind jedoch wichtig, um ein Frühwarnsystem aufzubauen, das bereits vor der Gefährdung des Projektendtermins greift.
Beispiel:
Ein Meilenstein kann laut Netzplanterminierung frühestens am 15.08. abgeschlossen sein. Lt. Vereinbarung mit dem Auftraggeber muss der Meilenstein spätestens am 01.09. erreicht sein. Fügt man diese Prämisse in den Netzplan ein (spätestes Ende des Meilensteins - Terminvorgabe), erhalten alle Vorgänge, die im Pfad vor dem Meilenstein liegen, zwei Wochen Puffer. Sind diese zwei Wochen Puffer aufgebraucht (bspw. durch unvorhergesehene Verzögerungen), werden die Vorgänge kritisch.
Die Möglichkeiten einer realitätsgetreuen Termin- und Ablaufplanung steigen, wenn ein Projektmanagementsystem eine Vielzahl so genannter Termineinschränkungstypen (Bsp.: Vorgang nicht früher/später als, muss anfangen/enden am usw.) bereitstellt. Auch der Cash-Flow - zum Beispiel spätestens möglich - lässt sich mit Hilfe spezieller Einschränkungstypen beeinflussen (vgl. unten: Wie gehe ich bei der Planoptimierung nach Kosten vor?) Doch wo Licht ist, fällt auch Schatten: Einschränkungstypen setzen zum Beispiel die Flexibilität des automatischen Kapazitätsabgleichs stark herab, weswegen deren sparsame Verwendung zu empfehlen ist.
Besonderes Augenmerk gilt in der Regel dem kritischen Pfad (kritischer Weg) eines Projektes, da dieser den Projektendtermin tangiert. Aus diesem Grund stellen fast alle PM-Systeme Mechanismen bereit, die den kritischen Pfad besonders hervorheben, zum Beispiel Filter!
Wie ist die Vorgehensweise zur Kostenoptimierung?
Eine Optimierung des Plans nach Kostenanfall kommt meist nur in Spezialfällen bei sehr großen Projekten vor. Hier kann es aber durchaus von Bedeutung sein, bestimmte kostenintensive Arbeitspakete so spät wie möglich zu beginnen - schließlich sind evtl. hohe Finanzierungskosten zu übernehmen.
Basis ist auch hier der Netzplan. Ähnlich wie bei der Optimierung nach Ressourcen können die Arbeitspakete nach hinten geschoben werden, um einen besseren Zahlungsverlauf zu erhalten. Zur Visualisierung wird z.B. eine Gegenüberstellung von geplanten Projekt-Kosten und Zahlungseingang verwendet.
Risikobetrachtung
Wozu dient eine Risikoanalyse?
Aufgabe der Risikoanalyse ist es, Faktoren, die eine Gefahr für den Projekterfolg (die im Projektauftrag definierte Leistung in geplanter Zeit mit den geplanten Ressourcen im vorgegebenen Budget zu erbringen) darstellen, zu identifizieren, zu bewerten und entsprechende Gegenmaßnahmen vorzubereiten bzw. einzuleiten.
Zu unterscheiden sind:
Im Rahmen der PM-Fibel wird im Weiteren auf die Projektrisiken eingegangen. Zum Risikomanagement der Produktrisiken existieren je nach Produktart (technische Produkte, Software, Anlagenbau, etc.) meist sogar firmenspezifische Konzepte (z.B. FMEA), die in der Regel Bestandteil des Qualitätsmanagements sind.
Wie finde ich Projektrisiken heraus?
Der erste Schritt der Risikoanalyse ist die Risikofindung. Ziel ist es, alle denkbaren Gefahren für den Projekterfolg zu identifizieren.
Hierfür gibt es zwei Quellen:
Typische Projektrisiken (Beispiele):
Eine sinnvolle Basis für die Risikofindung ist der Projektstrukturplan (siehe Kapitel Projektstrukturierung), den man auf jeder Ebene nach Projektrisiken durchsuchen kann!
Einige Projektplanungssysteme versuchen das Risiko einer Einzeitenschätzung (Bsp.: zu schlecht/gut geschätzt) herabzusetzen, indem sie dem Anwender die Möglichkeit offerieren, eine Mehrzeitenschätzung (Oft als sog. PERT - Analyse implementiert) vorzunehmen. Der Anwender gibt zum Beispiel eine pessimistische, eine realistische und eine optimistische Schätzung einer Projektvorgangsdauer ab. Die Software ermittelt mit Hilfe dieser Angaben eine wahrscheinliche Dauer des Vorgangs. Ob diese letztendlich "realistischer" ist, darf bezweifelt werden, da in der Regel auch die Eingangsparameter (drei Schätzwerte) wiederum mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor versehen sein dürften.
Wie lassen sich Projektrisiken bewerten?
Ein Risiko ist immer dann ein hohes Risiko, wenn zwei Eigenschaften erfüllt sind:
Dementsprechend ist es sinnvoll, die gefundenen Projektrisiken in ein Portfolio einzutragen.
Es empfiehlt sich, bei der Planung die "Top-Ten" der Risiken aufzustellen und diese bspw. monatlich zu aktualisieren - allein die gedankliche Beschäftigung mit möglichen Risiken verkürzt die Reaktionszeit beim tatsächlichen Eintreten erheblich!
Welche Möglichkeiten gibt es, um ein Risiko zu vermindern?
Maßnahmen zur Beherrschung von Risiken können entweder die Eintrittswahrscheinlichkeit reduzieren oder die Auswirkungen bei Eintreten eines Risikos mindern. Sowohl Präventiv- (Risikominimierung im Vorfeld) als auch Korrektiv-Maßnahmen (Notfallplanung) sind möglich.
In jedem Fall ist zu beachten:
Einleitung
Was ist Projektsteuerung und wozu dient sie?
Wie gehe ich bei der Projektsteuerung vor?
Die Projektsteuerung läuft periodisch in sich immer wiederholenden Schritten ab:
Ist-Zustand
Welche Ist-Daten benötige ich als Basis für die Projektsteuerung?
Ist-Daten können sich auf alle Parameter der Projektsteuerung beziehen:
Bei allen Ist-Daten sind zwei Aspekte zu beachten:
vergangenheitsbezogene Ist-Daten sind die "klassischen" Ist-Daten, die in vielen Betrieben schon aus betriebswirtschaftlichen Gründen erfasst werden. So gibt es häufig eine Ist-Aufwandserfassung, die alle Mitarbeiter z.B. wöchentlich zu führen haben. Aus diesen Daten lassen sich interessante Schlüsse ziehen, bspw. hinsichtlich der Aufteilung des gesamten Abteilungsaufwandes auf Neuentwicklungen, Fehlerbehebung, Produktbetreuung, Administration usw.. Vergangenheitsbezogene Ist-Daten dienen also hauptsächlich der Erfahrungssicherung.
Die Kernfrage lautet "Was ist bisher geschehen?"
Beispiele:
Immer mehr Planungssysteme ermöglichen eine Rückmeldung von Ist-Daten durch E-Mail. Der Projektverantwortliche überprüft die rück gemeldeten Daten und übernimmt sie (bei Plausibilität) in das eigentliche Planungssystem. Eine Alternative zu dieser Verfahrensweise sind die zu einigen PM-Systemen angebotenen Rückmelde-Module (Bsp.: Project Communicator für Project Scheduler 7 von Scitor). Sowohl die eine als auch die andere Alternative macht unter Umständen die Notwendigkeit einer Vollversion des jeweiligen Planungssystems/ Arbeitsplatz überflüssig: Es genügt bspw. ein E-Mail-Client oder das Rückmelde-Modul.
Vorteil: Kostenersparnis!
Zukunftsbezogene Ist-Daten:
Diese zukunftsbezogenen Informationen sind keine Ist-Daten im betriebswirtschaftlichen Sinne - vielmehr sind es aktualisierte Schätzungen. Diese Angaben (z.B. über einen voraussichtlichen Fertigstellungstermin) sind die Basis, um ein Frühwarnsystem aufzubauen - dem Hauptziel der Projektsteuerung! Die Kernfrage hierzu lautet "Wie werden die verbleibenden Arbeiten zu erledigen sein?".
Beispiele:
Die Frage nach dem voraussichtlichen weiteren Projektverlauf ist für die aktive Steuerung eines Projektes wichtiger als die Frage nach der Vergangenheit!
Welche Rolle spielt der Fertigstellungsgrad?
Der Fertigstellungsgrad (FG) beschreibt, wie weit eine Aufgabe (oder - verdichtet - ein Projekt) bereits fortgeschritten ist. Er ist eine interessante Kennzahl zur Berichterstattung.
Es gibt einen zeitlichen und einen leistungsmäßigen Fertigstellungsgrad:
Problematisch ist die Verwendung des FG bei der Ermittlung der Ist-Daten:
Auf die Frage "Zu wie viel Prozent sind Sie bereits fertig?" bekommt man häufig die Antwort "Zu 90%!". Hier wird jeder erfahrene Projektleiter sofort misstrauisch - häufig ist nämlich die Angabe "zu 90 % fertig" nicht gleichbedeutend mit "noch 10 % zu erledigen" - das sog. "90%-Syndrom" hat sich ausgewirkt. Dies ist ein rein psychologisches Problem. Denn mit der scheinbar exakten Zahl 90% soll nur ausgedrückt werden, dass schon sehr viel erledigt ist, ein bestimmter Rest aber noch verbleibt.
Ist-Analyse
Wozu sollte ich die Ist-Daten analysieren?
Die Erfassung der Ist-Daten ist der 1. Schritt. Um diese sinnvoll interpretieren zu können, müssen sie im 2. Schritt genauer untersucht werden. Ziel ist es herauszufinden, wie das Projekt im Vergleich zum ursprünglichen Plan weiter verlaufen wird und welche Auswirkungen die derzeitige Situation hat.
Zu diesem Zweck gibt es verschiedene Controlling-Methoden, von denen einige in den nächsten Kapiteln kurz vorgestellt werden sollen.
Soll-/Ist-Vergleich
Der Soll-/Ist-Vergleich ist mit Sicherheit das bekannteste und am weitesten verbreitete Instrument des Projektcontrollings. Ziel ist es, durch die Gegenüberstellung von ursprünglicher Planung (= Soll) und momentaner Planung (= Ist) Abweichungen transparent zu machen und deren Auswirkungen auf den weiteren Projektverlauf abzuschätzen.
Um Planabweichungen während des Projektverlaufs sichtbar zu machen, stellen PM-Systeme eine mehr oder weniger große Anzahl von Zwischenplänen bereit, die quasi eine Momentaufnahme des zu diesem Zeitpunkt aktuellen Projektstandes verkörpern. Diese lassen sich mit dem ursprünglichen Projektplan (Basisplan) vergleichen, wodurch Abweichungen schnell sichtbar werden. Einige PM-Systeme - z.B. MS Project - speichern allerdings nicht alle relevanten Projektdaten in den Zwischenplänen ab, die sie im Basisplan dagegen vertreten sind!
Der Soll-/Ist-Vergleich kann für alle Steuerungsparameter (Termine, Aufwände, Kosten) gemacht werden, wie in folgenden Graphiken veranschaulicht:
Allen Darstellungsformen ist gemeinsam, dass unbedingt eine Linie eingezeichnet sein muss, die den Stichtag kennzeichnet, auf den sich die Ist-Daten beziehen. Nur dadurch lässt sich erkennen, welche der Angaben sich auf die Vergangenheit und welche sich auf die Zukunft beziehen (siehe Kapitel Ist-Datenerfassung).
Wichtig für alle Darstellungen ist, dass die zukunftsbezogenen Ist-Daten ganz genauso in die Planung eingearbeitet werden müssen, wie dies mit den Plandaten der Erstplanung der Fall war. So wird also z.B. der Netzplan (siehe Kapitel Ablaufplanung) mit den aktualisierten Schätzungen der Arbeitspaketdauern und dem Stichtag als frühest möglichem Startzeitpunkt neu berechnet.
Heraus kommt eine aktualisierte Planung, die Ist-Daten enthält - und damit eine höhere Planungsqualität besitzen sollte als die Erstplanung, bei der ja noch kein Teil des Projektes realisiert war.
Meilenstein-Trend-Analyse
Die Meilenstein-Trend-Analyse (MTA) ist ein sehr einfaches und übersichtliches Instrument zur manuellen Darstellung des Projektstatus. Voraussetzung für die Anwendung der MTA ist ein realistischer Terminplan in Form von richtig definierten Meilensteinen (siehe Kapitel Meilensteine).
Die MTA wird während der gesamten Projektdauer in einer einzigen Graphik fortgeschrieben. Diese besteht im Wesentlichen aus einem Dreieck, auf dessen Vertikalen die MS-Plantermine zu den jeweiligen Berichtszeitpunkten in der Horizontalen eingetragen werden. Das bedeutet, dass z.B. alle 2 oder 4 Wochen die MS-Verantwortlichen um eine Aussage gebeten werden, wann ihr Meilenstein vollständig erreicht sein wird. Dieser Termin wird entsprechend eingetragen. Erfolgt eine Änderung des Plantermins (oder der MS-Ergebnisse!), muss dies dokumentiert werden. Auf diese Art und Weise entsteht praktisch "automatisch" eine Dokumentation der wichtigsten Planänderungen und deren Gründe im Projektverlauf.
Die Vorteile der Meilenstein-Trend-Analyse
Die Verantwortlichen werden periodisch mit der gesamten Projektplanung konfrontiert - dies fördert gesamtheitliches Denken.
Maßnahmendefinition
Welche Steuerungsmaßnahmen sind grundsätzlich möglich?
Werden bei der Auswertung der Ist-Daten durch obige Instrumentarien mögliche Probleme bei der weiteren Projektabwicklung bzgl. Kosten, Aufwand, Terminen oder Produktqualität erkannt, müssen Gegenmaßnahmen getroffen werden.
Mögliche Maßnahmen bei drohendem Terminverzug
Wie lassen sich Steuerungsmaßnahmen beurteilen?
Wesentlich für die Beurteilung von Steuerungsmaßnahmen sind zwei Faktoren:
Um die richtige Maßnahme auszuwählen, müssen diese beiden Faktoren gegeneinander abgewogen werden. Ein Patentrezept dafür gibt es aber leider nicht!
Wie könnte ein Projekt-Statusbericht aussehen?
Der Projekt-Statusbericht dient vor allem dazu, die Entscheidungsträger eines Unternehmens bzw. den Auftraggeber über den Status eines Projektes zu informieren. Falls in einem Unternehmen mehrere Projekte laufen, über die regelmäßig berichtet wird, ist es sinnvoll, einen einheitlichen Statusbericht zu definieren.
Ein Projekt-Statusbericht sollte berücksichtigen:
Fast alle Projektplanungssysteme bieten eine Fülle von vordefinierten und anpassbaren Berichten, Analysen, Ansichten etc. zur Ausgabe auf Bildschirm und Drucker oder zum Publizieren im Intra-/Internet, die Sie für aussagekräftige Projekt-Statusberichte verwenden können.
Entlastung des Projekts
Was ist der Projektabschluss?
Ein Projekt ist abgeschlossen, wenn das Projektziel erreicht ist. Ohne ein klar definiertes Projektziel (siehe Kapitel Zieldefinition) ist es schwierig, ein Projekt ordentlich abzuschließen! In Sonderfällen enden Projekte auch durch Abbruch. Auch dann ist ein systematischer Projektabschluss wichtig!
Der Projektabschluss ist der offizielle Schlusspunkt eines Projektes. Danach fallen keine Aufwände für die Erreichung des Projektziels mehr an.
Wozu ist ein Projektabschluss gut?
Der geordnete Projektabschluss dient verschiedenen Zielen:
Während der oft hektischen und stressigen Abwicklung von Projekten entstehen häufig latente Konflikte zwischen Projektbeteiligten. Der Projektabschluss ist der späteste Zeitpunkt, um diese evtl. entstandenen Gräben wieder zu "kitten"!
Wie sollte eine Projektabschlusssitzung ablaufen?
Folgende Themen haben sich in einer Projektabschlusssitzung bewährt:
1. Rückschau
2. Anerkennung und Kritik
3. Erfahrungssicherung für künftige Projekte
4. Überführung der Projektteammitglieder in neue Aufgabengebiete
5. Information über den Projektabschluss
6. Abschlussfeier
Wie ist ein Projektabschlussbericht aufgebaut?
Folgender Aufbau ist empfehlenswert:
Arten
klassisches Vertragsrecht:
Z.B. BGB, VOB sowie Musterverträge und Eigen Konstrukte. Diese Art ist umfassend und vollständig formuliert. Start und Ende sind eindeutig definiert und fixiert. Die gegenseitigen Leistungsforderungen und Leistungserwartungen sind fest meistens fix festgelegt. Die hieraus entstehende starre Vertragsbindung lässt eine Beziehungsintensität beider Vertragsparteien wenig zu. Der punktuelle Austausch zu den vereinbarten Leistungen ist vordergründig.
Neoklassisches Vertragsrecht:
Weiterentwicklung des klassischen Vertragsrechts. Einem kurzfristigen oder einmaligen Leistungsaustausch wird eine längerfristig angelegte Beziehung beigefügt. Z.B. bei Dauerschuldverhältnissen. Dieser Dauerhafte Moment der längerfristig angelegten Beziehung kann durch Veränderungen von Rahmenbedingungen Unsicherheiten erzeugen.
Relationale Veträge:
Ausgehandelte Veträge besitzen hier eher einen Rahmencharakter. Die
gegenseitigen Verpflichtungen ergeben sich nicht ausschließlich aus dem Vertrag
sondern aus einer Vielzahl in Sozialverpflichtungen wurzelnden
Verpflichtungselementen.
Die beidseitigen Leistungsverpflichtungen sind
weitgehend diffus gehalten und werden nach Bedarf in gegenseitigem Einvernehmen
konkretisiert. Konflikte werden schadensfrei gelöst, weil die soziale Bindung
Motivation zur Zusammenarbeit ist. Einvernehmliche Konfliktlösungen genießen
Vorrang gegenüber streitiger Entscheidungsfindung.
In Relation zu den sehr eng
gefassten klassischen Veträgen die unter Umständen kontraproduktiv wirken können,
ist hier ein nach allen Seiten offenes Regelwerk mit offenen und unscharfen
Regeln dargelegt.
Intensive Kommunikation, personal relationships, Sicherheit
und Wohlempfinden haben Vorrang vor hinderlichen und einengenden Vertragswerken.
Das Offenhalten von Lücken ermöglicht beiden Parteien den aktuellen
Handlungsrahmen durch speziell erarbeitete Arrangements kreativ zu füllen. Der
Kommitment zum Vertragspartner ist das entscheidende Kriterium. Probleme werden
nicht gerichtlich gelöst, sondern in gemeinsamer Absprache in direkten
Verhandlungen.
Sinn ist eine gesunde Fortführung der Beziehung. Hierbei spielen
möglich entstehende Gerichtskosten keine Rolle. Bedeutung hat einzig und allen
die Arbeitsatmosphäre zwischen den Vertragspartnern. Die Entscheidungsgewalt
obliegt weiterhin den Parteien und wird nicht in gerichtliche Hände gegeben.
Die
Praxis zeigt: Abweichungen und Änderungen sind mit zunehmender Komplexität und
auch zunehmender Dauer fast unausweichlich.
In diesem Fall ist eine
vertragsinterne Lösung, durchaus unter Einbeziehung von Meditation geneigt,
schneller, und eine beidseitig sauberere Lösung eine anzustrebende "win-win Situation" herbei führen
zu können, anstatt notwendige Energien in womöglich jahrelangen Prozessen zu
verbrennen.
Ablaufplan
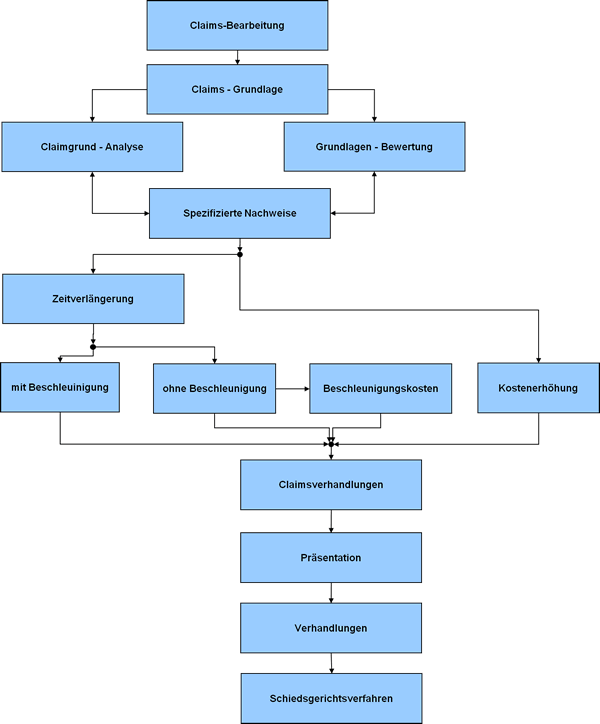
|
Modernes Arbeiten
Diese Seite befindet sich im Aufbau. |
Inhalt
| 90%-Syndrom | Gefahr der Überschätzung des Fertigstellungsgrades eines Arbeitspakets. Der Bearbeiter gibt an, ein Arbeitspaket zu 90 % erledigt zu haben, der wahre Arbeitsfortschritt liegt jedoch darunter. |
| Ablaufplanung | Zeitliche und logische Anordnung der Arbeitspakete eines Projektes. Das Ergebnis der Ablaufplanung ist der Netzplan. |
| Anfangsfolge | Anordnungsbeziehung vom Anfang eines Arbeitspakets zum Anfang seines Nachfolgers, d.h. der Start von Arbeitspaket B richtet sich nach dem Start von Arbeitspaket A. |
| Anfangszeitpunkt | Auf Basis der Ablaufplanung errechneter oder fest definierter Beginn
eines Arbeitspaketes. Abhängig von der Berechnungsmethode ergeben sich: * Frühester Anfangszeitpunkt (Vorwärtsrechnung) * Spätester Anfangszeitpunkt (Rückwärtsrechnung) |
| Anordnungsbeziehung (= Verknüpfung) | Quantifizierbare Abhängigkeit zwischen zwei Arbeitspaketen eines
Projektes: * Normalfolge (Ende - Anfang) * Anfangsfolge (Anfang - Anfang) * Endfolge (Ende - Ende) * Sprungfolge (Anfang - Ende) |
| Arbeitspaket | Teil eines Projektes, der im Projektstrukturplan nicht weiter aufgegliedert ist. Ein Arbeitspaket kann auf einer beliebigen Gliederungsebene liegen. Um das Projektziel zu erreichen, ist die Abarbeitung aller Arbeitspakete nötig. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden Arbeitspakete häufig auch mit "Aufgabe", "Aktivität" oder "Vorgang" bezeichnet, in Microsoft Project 98 "Vorgang". |
| Arbeitspaketverantwortlicher | Ansprechpartner für den Projektleiter bei der Durchführung eines Arbeitspakets. Der AP-Verantwortliche muss nicht unbedingt alle Arbeiten selbst durchführen. |
| Auftraggeber eines Projektes | Gesamtverantwortlicher für ein Vorhaben oder ein Projekt. Der Auftraggeber genehmigt das Projektbudget und die Rahmentermine. |
| Aufwand | Der Aufwand eines Arbeitspakets beschreibt die Arbeitsmenge, die notwendig ist, um ein definiertes Arbeitsergebnis zu erbringen. Microsoft Project 98 verwendet die Bezeichnung "Arbeit". Einheit: Personentage (PT), Personenstunden (PH), etc. |
| Aufwandsschätzung | Abschätzung des zur Abarbeitung eines Arbeitspakets notwendigen Aufwandes (100% "reine Projektarbeit") sowie der Bearbeiter. Sie basiert vor allem auf Erfahrungen und ist die Grundlage für die Kapazitäts- und Terminplanung. |
| Balken-Netzplan (= vernetzter Balkenplan) | Erweiterung des Balkenplans um die Darstellung der Abhängigkeiten zwischen den Arbeitspaketen. |
| Balkenplan (= Gantt - Diagramm) | Diagramm zur Visualisierung der Zeitplanung eines Projektes. Die Dauer eines Arbeitspakets wird durch die Länge des Balkens in der Zeitachse symbolisiert. Die Balken können sowohl Ist- als auch Soll-Daten umfassen. Ereignisse werden als Zeitpunkte dargestellt. |
| Belastungsdiagramm | Graphik zur Visualisierung der Belastung von Mitarbeitern (oder Abteilungen) durch Arbeitspakete aus ein oder mehreren Projekten. |
| Dauer | Zeitspanne vom Anfang bis zum Ende eines Arbeitspaketes. Einheit: Tage, Stunden, Wochen, etc. Sie wird entweder direkt geschätzt oder richtet sich nach der Bearbeitungsdauer der einzelnen Ressourcen. |
| Einsatzplanung (=Ressourcenplanung) | Planung des zeitlichen Einsatzes der an der Projektdurchführung beteiligten Ressourcen, abhängig von ihrer Verfügbarkeit. |
| Endfolge | Anordnungsbeziehung vom Ende eines Arbeitspaketes zum Ende seines Nachfolgers, d.h. Arbeitspaket B kann erst abgeschlossen werden, wenn Arbeitspaket „A“ bereits abgeschlossen ist. |
| Endzeitpunkt | Auf Basis der Ablaufplanung errechnetes oder fest definiertes Ende
eines Arbeitspaketes. Als Abhängig von der Berechnungsmethode ergeben sich: * Frühester Endzeitpunkt (Vorwärtsrechnung) * Spätester Endzeitpunkt (Rückwärtsrechnung) |
| Entscheidungsgremien | Instanzen der Projektorganisation wie z.B. Lenkungsteam, Steuerungskreis, Controlling - Ausschuss usw. Sie sind in der Regel dafür zuständig, projektübergreifende Konflikte zu lösen und Prioritäten zu vergeben. |
| Fertigstellungsgrad | Prozentsatz, zu dem die Arbeiten an einem Arbeitspaket abgeschlossen sind. |
|
Freier Puffer |
Der Zeitraum, um den ein Arbeitspaket im Netzplan verschoben werden kann, ohne daß ein anderes Arbeitspaket ebenfalls verschoben wird. |
| Gantt - Diagramm (=Balkenplan) | Diagramm zur Visualisierung der Zeitplanung eines Projektes. Die Dauer eines Arbeitspakets wird durch die Länge des Balkens in der Zeitachse symbolisiert. Die Balken können sowohl Ist- als auch Soll-Daten umfassen. Ereignisse werden als Zeitpunkte dargestellt. |
|
Gesamtpuffer |
Zeitraum, um den ein Arbeitspaket im Netzplan verschoben werden darf, ohne dass das geplante Ende des Projektes verschoben werden muss. |
| Interdisziplinäre Zusammensetzung | Zusammensetzung eines Projektteams aus Mitarbeitern unterschiedlicher Bereiche eines Unternehmens, um deren unterschiedliche menschliche und fachliche Stärken zum Erreichen des Projektziels zu nutzen. |
| Kapazitätsbedarf (= Ressourcenbedarf) | Bedarf an Personal, das für die Abarbeitung der Arbeitspakete eines Projektes nötig ist, ermittelt aus dem geschätzten Aufwand und der Zeitrechnung des Netzplans. |
| Kapazitätsplanung | Namentliche und quantitative Zuordnung der ausführenden Kapazität(en) (Ressourcen) zu jedem einzelnen für das Projekt notwendige Arbeitspaket unter Berücksichtigung der Aufwandsschätzung. |
| Kapazitätstreue Einsatzplanung | Zeitplanung unter Berücksichtigung der max. Verfügbarkeit der ausführenden Ressourcen. |
| Kernteam (=Projektteam) | Projektmitarbeiter, die zusammen mit dem Projektleiter für die Projektdurchführung verantwortlich sind. |
| Kick-Off-Sitzung (= Projekt-Kick-Off) | Erstes Treffen von Projektleiter und Projektteam zur Initialisierung eines Projektes. Dabei werden der Projektauftrag, Projektziele, -inhalte, -termine und deren Rahmenbedingungen diskutiert, die Teammitglieder miteinander bekannt gemacht sowie die weitere Vorgehensweise beschlossen. |
| Kreativitätstechniken | Methoden zur Anregung der Kreativität bei der Erarbeitung neuartiger Problemlösungsansätze. |
| Kritischer Weg | Alle Arbeitspakete eines Netzplans, die zeitlich nicht verschoben werden können, ohne dass sich eine Verschiebung des Projektendtermins ergibt, liegen auf dem kritischen Weg. |
| Matrix-Projektorganisation | Form einer Projektrahmenorganisation. Mischform zwischen reiner Projektorganisation und Projektkoordination. Verantwortung und Befugnisse sind zwischen Projektleiter und den beteiligten Linienfunktionen aufgeteilt. |
| Meilenstein | Ereignis von besonderer Bedeutung im Projektverlauf. Ein Meilenstein hat immer die Dauer = 0 Tage! |
| Meilenstein-Trend-Analyse | Instrument für das Termin-Controlling eines Projektes: An regelmäßigen Berichtszeitpunkten wird die Terminplanung des Projektes durch die Abfrage von Meilensteinterminen graphisch neu erfasst. Aus dem Kurvenverlauf läßt sich ein Trend über die Termintreue des Projektes ableiten. |
| Mengenmethode | Methode zur Bewertung des Fertigstellungsgrades von
Projektaktivitäten: Ein Arbeitspaket ist in eine Menge von gleichartigen Objekten mit jeweils demselben Arbeitsaufwand untergliedert (z.B. 30 etwa gleichartige Graphiken). Aus der Anzahl der fertig gestellten Objekte lässt sich der Fertigstellungsgrad schätzen. Damit wird das sog. "90%-Syndrom" vermieden. |
| Multiprojekt-Controlling | Analyse des Zusammenwirkens aller Projekte, um projektübergreifende Ressourcenkonflikte (Personalkapazitäten, Hilfsmittel, Finanzen) aufzudecken und geeignete koordinierende Maßnahmen einleiten zu können. |
| Multiprojektmanagement | Aufgabe des Multiprojektmanagements ist es, mehrere Einzelprojekte so zu koordinieren (z.B. hinsichtlich der benötigten Ressourcen), dass das Gesamtergebnis aller Projekte hinsichtlich der Unternehmensziele ein Optimum ergibt. |
| Netzplan | Graphische Darstellung der Abhängigkeiten zwischen Arbeitspaketen, also der Vorgehensweise bei der Projektabwicklung. |
| Netzplantechnik | Rechenmethode zur Ermittlung der frühestens möglichen sowie spätestens notwendigen Anfangs- und Endzeitpunkte der Arbeitspakete. |
| Normalfolge | Anordnungsbeziehung vom Ende eines Arbeitspaketes zum Anfang seines Nachfolgers, das heißt mit Arbeitspaket B kann erst begonnen werden, wenn Arbeitspaket A abgeschlossen ist. |
| Personaleinsatz | Intensität, mit der „eine“ Ressource ein Arbeitspaketes abarbeitet.
Ist der Personaleinsatz hoch, ergibt sich eine kurze Bearbeitungsdauer und
umgekehrt. Einheit: Prozent oder Personenstunden / Tag |
| Phasenmodell | Standardisierter Projektstrukturplan der in zeitlich voneinander
abhängige Abschnitte gegliedert ist. Diese können sequentiell aufeinander
folgen oder sich überlappen. Beispiel: Analyse - Konzept - Entwicklung - Realisierung - Test |
| Projekt | Vorhaben, das folgende Kriterien erfüllt: * Einmaligkeit, keine Routinetätigkeit * eindeutige Zielvorgabe * zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Begrenzungen * hohe Komplexität (Indikatoren: Aufwand, Anzahl an beteiligten Abteilungen, Risiko) |
| Projektabschluss | Letzte Phase des Projektlebenszyklus, in der * das Projektergebnis an den Auftraggeber übergeben, * die Projektorganisation aufgelöst und * ein Resümee aus dem zurückliegenden Projektverlauf gezogen wird (zur Erfahrungssicherung für zukünftige Projekte). Nach dem Projektabschluss ist das Projekt offiziell zu Ende. |
| Projektabschlußbericht | Bericht des Projektleiters mit einer Zusammenfassung des Projektverlaufs. |
| Projektabschlusssitzung (=Projekt - Review) | Letzte Sitzung des Projektteams, in der die Erfahrungen aus der Projektabwicklung diskutiert werden. Ferner wird festgelegt, wer über den Projektabschluss und dessen Ergebnis informiert werden soll. |
| Projektantrag | Ein noch nicht erteilter Projektauftrag, der alle Informationen enthält, nach denen eine Entscheidung über ein Projekt gefällt werden kann. |
| Projektarten |
Kategorisierung von Projekten, um leichter Standards (z.B.
Standard-Projektstruktur) entwickeln zu können. |
| Projektcontrolling (= Projektsteuerung) | Aufgabe des Projektleiters. Ziel ist es, mögliche Probleme während der Projektabwicklung möglichst frühzeitig zu erkennen und evtl. Steuerungsmaßnahmen ergreifen zu können. |
| Projektkoordination | Form einer Projektrahmenorganisation. Für die Dauer eines Projektes wird die bestehende Linienorganisation um die Stabsfunktion eines Projektkoordinators erweitert. Sie besitzt keinerlei Entscheidungs- und Weisungsbefugnis gegenüber den Linienfunktionen. |
| Projektlebenszyklus | Genereller Ablauf eines Projektes aus Sicht des Projektmanagements. Er
besteht aus folgenden Abschnitten: * Projektstart * Projektplanung * Projektsteuerung * Projektabschluss |
| Projektleiter | Verantwortlicher für die Erreichung der im Projektauftrag fixierten Projektziele. Er ist erster Ansprechpartner des Auftraggebers. Aufgaben, Befugnisse und Verantwortung des Projektleiters sollten unternehmensweit festgelegt sein. |
| Projektmanagement | Projektmanagement ist eine Führungskonzeption, die dazu dient, Projekte zielorientiert und effizient abzuwickeln. Dazu gehören organisatorische, methodische und zwischenmenschliche Aspekte. |
| Projektmanagementhandbuch | Wird häufig die Dokumentation grundlegender Festlegungen für die einheitliche Anwendung von Projektmanagement in einem Unternehmen genannt. |
| Projektmanagementsoftware | Hilft dem Projektleiter bei der Anwendung von Planungs- und Controlling-Methoden, ersetzt jedoch nicht den gesunden Menschenverstand. |
| Projektmitarbeiter | Alle an einem Projekt beteiligten Personen, auch wenn sie nicht zum Projektteam gehören. |
| Projektorganisation | Die Projektorganisation besteht primär aus dem Auftraggeber, dem Projektleiter und dem Projektteam, kann jedoch den Erfordernissen entsprechend um weitere Kontroll- und Entscheidungsgremien erweitert werden. Mit dem Ende des Projektes wird die Projektorganisation aufgelöst. |
| Projektphasen | Zeitlich voneinander abhängige Abschnitte eines Projektablaufs.
Beispiel: Analyse - Konzept - Entwicklung - Realisierung - Test |
| Projektplanung | Alle Tätigkeiten, die zu einem Projektplan führen. Ein Projektplan
kann aus folgenden Elementen bestehen: * Projektstrukturplan inkl. Arbeitspaketbeschreibungen * Terminplan (Netz-, Balken-, Meilensteinplan) * Ressourcenplan * Kostenplan * Risikoanalyse |
| Projektrahmenorganisation | Zusammenwirken von Projekt- und Linienorganisation. Mögliche Formen
sind: * Reine Projektorganisation * Projektkoordination * Matrix-Projektorganisation Je nach Organisationsform besitzt der Projektleiter mehr oder weniger Verantwortung und Befugnisse. |
| Projektsteuerung (= Projektcontrolling) | Aufgabe des Projektleiters. Ziel ist es, mögliche Probleme während der Projektabwicklung möglichst frühzeitig zu erkennen und evtl. Steuerungsmaßnahmen ergreifen zu können. |
| Projektstrukturierung | Erarbeiten eines Projektstrukturplans. Ein Projekt wird hierarchisch in immer kleinere Elemente zerteilt. Die unterste Ebene ist die Basis für die weitere Projektplanung. |
| Projektstrukturplan | (Meist graphische) Übersicht über alle zur Erreichung des Projektziels erforderlichen Arbeitsschritte. |
| Projektteam (= Kernteam) | Projektmitarbeiter, die zusammen mit dem Projektleiter für die Projektdurchführung verantwortlich sind. |
| Projektziel | Das Projektziel ist Bestandteil des Projektauftrags und besteht aus
den drei Komponenten * Inhalt * Zeit * Kosten Es muss erreichbar, vollständig, widerspruchsfrei, nicht interpretierbar, prüfbar, lösungsneutral, dokumentiert und zwischen AG und PL abgestimmt sein. |
| Reine Projektorganisation | Form einer Projektrahmenorganisation. Für die Dauer eines Projektes werden die beteiligten Mitarbeiter zu einer selbständigen Organisationseinheit zusammengefasst und dem Projektleiter unterstellt. |
| Ressourcenplanung (= Einsatzplanung) | Planung des zeitlichen Einsatzes der an der Projektdurchführung beteiligten Ressourcen, abhängig von ihrer Verfügbarkeit. |
| Rückwärtsrechnung | 2. Schritt der Netzplanberechnung, in dem die spätestens möglichen Anfangs- und Endzeitpunkte der Arbeitspakete ermittelt werden. |
| Sprungfolge | Anordnungsbeziehung vom Anfang eines Arbeitspaketes zum Ende seines Nachfolgers, d.h. das Ende von Arbeitspaket B ist abhängig vom Beginn des Arbeitspakets A. |
| Statusbericht | Vom Projektleiter zu erstellende Übersicht über den aktuellen Projektstand (Soll-/Ist-Vergleich von Terminen, Kosten, Aufwände) als Information für den Auftraggeber. Ein Statusbericht wird in regelmäßigen Abständen oder bei Erreichen bestimmter Meilensteine angefertigt. |
| Terminplanung | Planung der Anfangs- und Endzeitpunkte aller Arbeitspakete eines Projektes. |
| Termintreue Einsatzplanung | Planung ohne Berücksichtigung der max. Verfügbarkeit der ausführenden Kapazitäten (Kapazitätsbedarfsplanung). |
| Verknüpfungen (= Anordnungsbeziehung) | Quantifizierbare Abhängigkeit zwischen zwei Arbeitspaketen eines
Projektes: * Normalfolge (Ende - Anfang) * Anfangsfolge (Anfang - Anfang) * Endfolge (Ende - Ende) * Sprungfolge (Anfang - Ende) |
| Vorwärtsrechnung | 1. Schritt der Netzplanberechnung, in dem die frühestens möglichen Anfangs- und Endzeitpunkte der Arbeitspakete ermittelt werden. |
| Zeitabstand (=Zeitwert) | Wird einer Anordnungsbeziehung zugeordnet. Er kann größer als, kleiner
als oder gleich Null sein. Beispiele: "Normalfolge mit +3 Tagen Zeitabstand" bedeutet, dass der Nachfolger erst 3 Tage nach dem Ende des Vorgängers starten darf. "Normalfolge mit -3 Tagen Zeitabstand" bedeutet, dass der Nachfolger schon 3 Tage vor dem Ende des Vorgängers starten darf. |
| Zeitwert (=Zeitabstand) | Wird einer Anordnungsbeziehung zugeordnet. Er kann größer als, kleiner
als oder gleich Null sein. Beispiele: "Normalfolge mit +3 Tagen Zeitwert" bedeutet, dass der Nachfolger erst 3 Tage nach dem Ende des Vorgängers starten darf. "Normalfolge mit -3 Tagen Zeitwert" bedeutet, dass der Nachfolger schon 3 Tage vor dem Ende des Vorgängers starten darf. |
Empfehlungen
Mögliche Downloads und Empfehlungen sind in Prüfung und werden, nach Bedarf, entsprechend vorgestellt. |